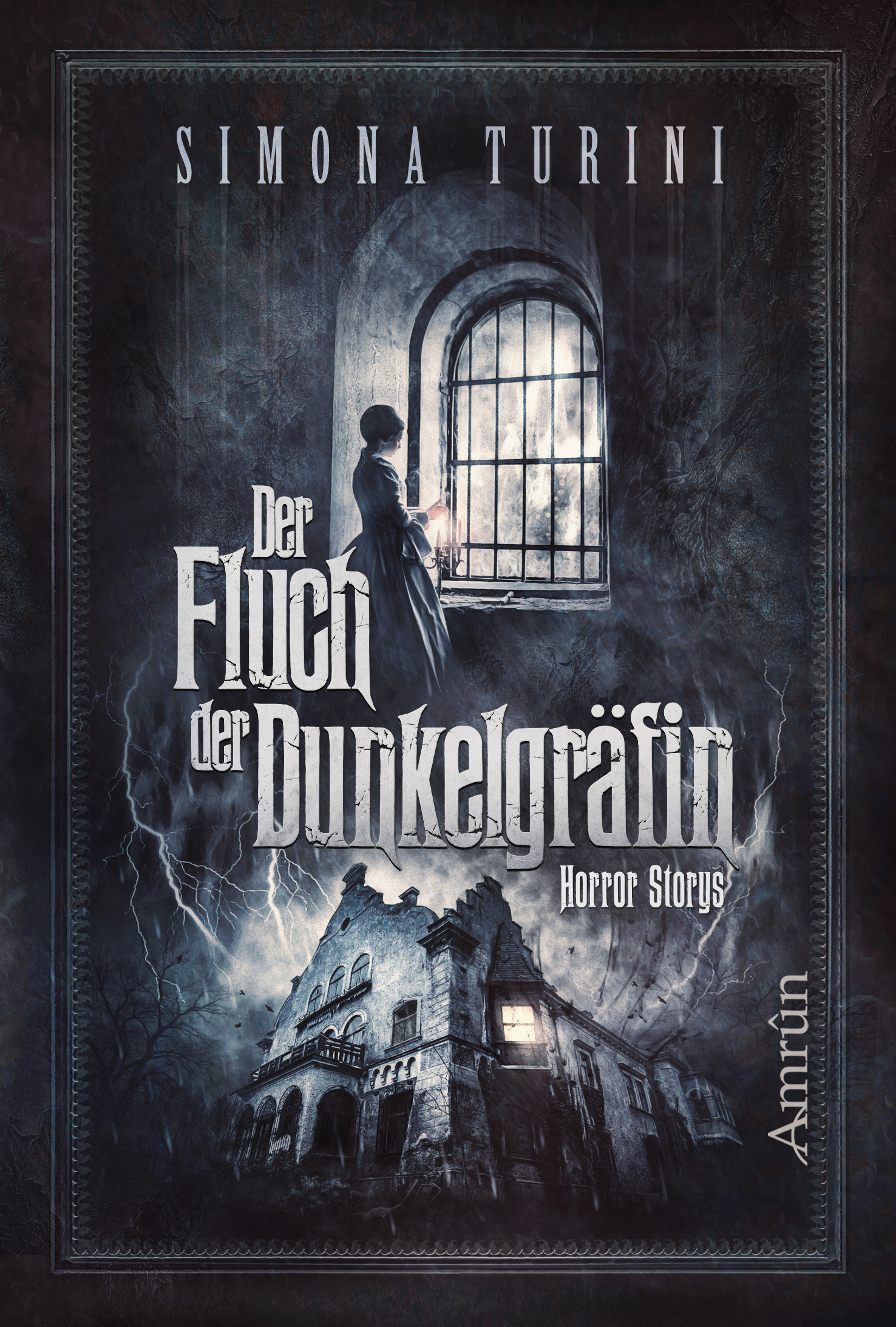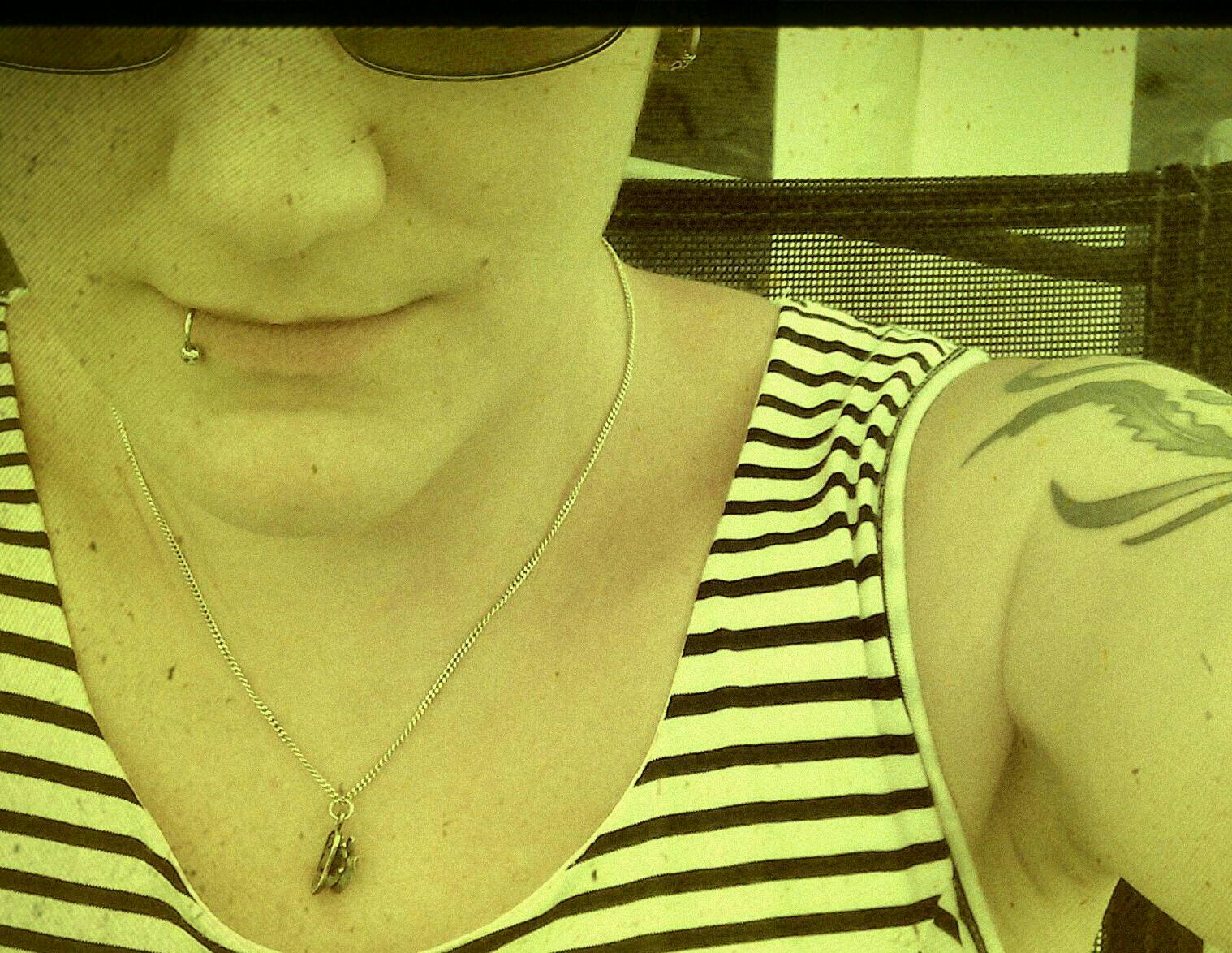2025 brachte neue Herausforderungen & großartige Chancen – ich habe eine Ausbildung zur Yogalehrerin begonnen, die mich sehr glücklich macht. Ich habe ein Buch geschrieben, das noch in diesem Jahr finalisiert wird und im nächsten Frühjahr erscheint. Ich habe ein Buch verkauft, das ich nun langsam mal schreiben sollte, damit es in zwei Jahren erscheinen kann. Ich habe Romane und Comics übersetzt. Ich habe Geschichten vorgelesen.
2025 brachte aber auch massenhaft Abschiede. Im Frühjahr starb T., eine liebe Freundin und ehemalige Mitbewohnerin. Kurz darauf im Sommer ging J., mein Partner in Art und Freund für mehr als 20 Jahre. Dann war es E., die von uns ging, eine liebe Bekannte und Klubpartnerin, deren kluge Einsichten und angenehme Ruhe mir fehlen werden. Schließlich traf es einen einen respektierten Literaturwissenschaftler, mit dem ich im Karlsruher Literaturhaus angenehme Gespräche führen durfte. Und jetzt, kurz vor Schluss, stirbt mein Onkel L. Ein bisschen viel Tod für ein Jahr, finde ich. Darauf könnte ich verzichten und empfehlen würde ich es auch nicht.
Allerdings ist Wandel – und damit eben auch der Tod – nun mal Teil des Lebens. Trauer ist angemessen, soll aber nicht alles überschatten, was es noch gibt. Soll nicht die überschatten, die noch nicht gestorben sind.
Leichter gesagt als getan, wenn obendrein das Jahr eine heftige depressive Episode über Monate mit sich bringt und dann noch die üblichen nervigen Zipperlein des mittleren Alters. Ich prophezeie: Ich werde eine sehr nögelige, sehr genervte alte Frau werden, denn besagte Zipperlein gehen ja sicherlich eher nicht wieder weg, sondern dürften sich mit den Jahren nur immer weiter vermehren. Auch das: Keine Empfehlung.
Was also tun? Na, den Wandel umarmen, weitermachen, vielleicht ein bisschen wachsen. Weniger nörgelig sein. Weniger Erwartungen pflegen. Stattdessen: Optimismus pflegen!
Also: Siehe Absatz 1 mit den tollen Chancen.